-
Lombroso und der geborene Verbrecher
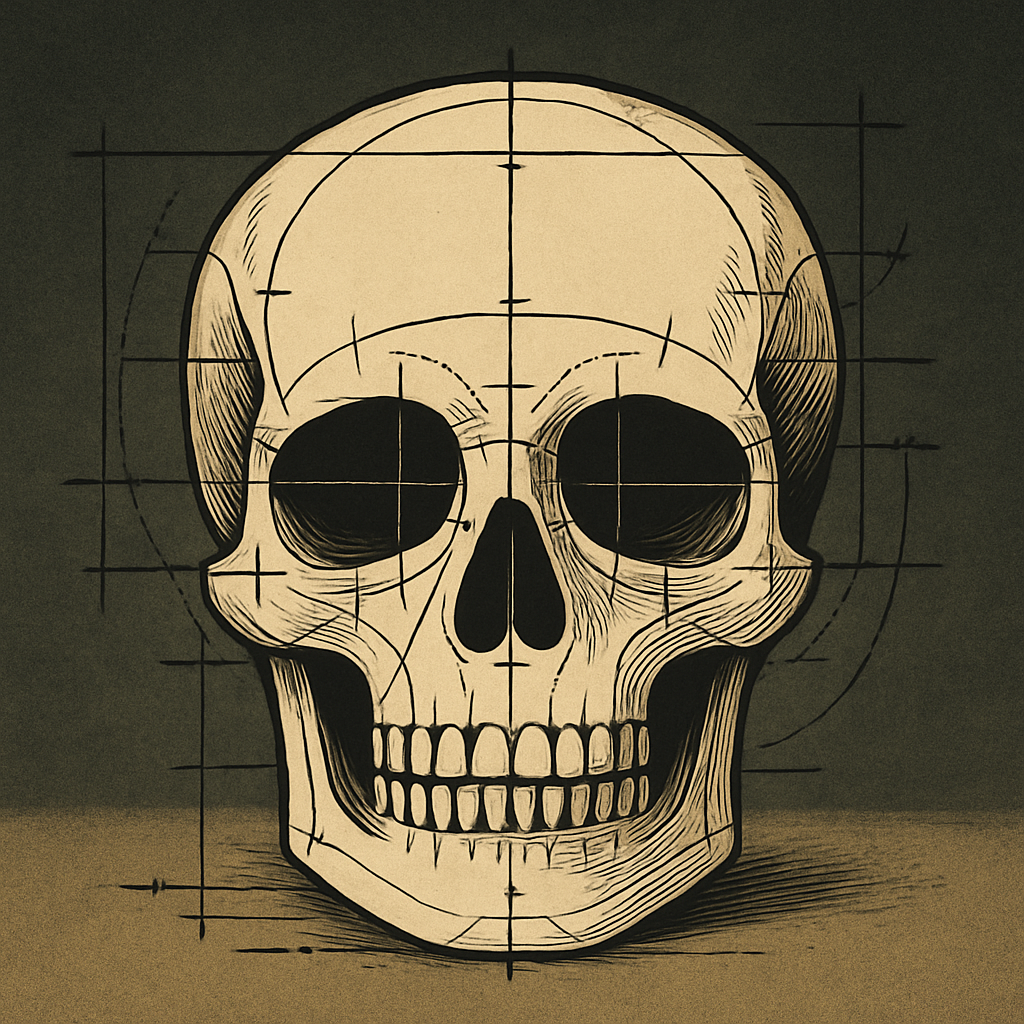
An einem dunklen, kalten Dezembermorgen des Jahres 1870 untersuchte Cesare Lombroso – 35 Jahre alt, Arzt und Dozent an der Universität Pavia – den Schädel eines Toten namens Giuseppe Villella, eines verurteilten Straftäters, gestorben sechs Jahre zuvor im Gefängnis. Er entdeckte eine Vertiefung in der mittleren Hinterhauptsgrube und mit einem Mal, so schrieb er später, sei ihm alles klar geworden: „In jenem Augenblick, als ich in Villellas Schädel jene Vertiefung entdeckte, sah ich – wie durch eine plötzliche Erleuchtung – das Wesen und den Ursprung des Verbrechens.“
-
Die Guillotine von Rheinland-Pfalz

Der 11. Mai 1949 schloss in Rheinland-Pfalz eine Unternehmung ab, die dem Zweck diente, Menschen zu töten: Die neue Guillotine in der Haftanstalt Mainz war einsatzbereit. Raum 27, frisch gekalkt, mit Abflussrinnen im Boden, war als Hinrichtungsstätte eingerichtet. Das Fallbeil war montiert, ein Ersatzmesser lag bereit, der Scharfrichter stand unter Vertrag. Die noch junge Landesverfassung stellte das Leben zwar unter den Schutz des Artikels 3 – schränkte diesen aber im selben Atemzug ein: Es könne „auf Grund des Gesetzes als Strafe für schwerste Verbrechen gegen Leib und Leben durch richterliches Urteil verwirkt erklärt werden“. Zwei Sätze im juristischen Spagat.
-
Der Fall Jenny Fischer

Jenny ist ein Fall, den Rauschgiftfahnder Jörg Schmitt-Kilian vor Jahren lösen konnte. Er erlebte bei den Ermittlungen gegen eine „Mörderin auf Raten“ mehr als eine Überraschung. Als der für das Rauschgiftkommissariat der Zentraldienststelle in dieser Region zuständige Kommissar wird er von dem örtlichen Rauschgiftsachbearbeiter um Unterstützung bei Ermittlungen gebeten. Seine Kollegen überwachen seit Wochen in einem kleinen Dorf den Telefonanschluss einer Jenny Fischer. Merkwürdig erscheint, dass die junge Frau konspirativ und hochprofessionell ihren Heroinhandel betreibt, obwohl zu ihrer Person keinerlei polizeiliche Erkenntnisse vorliegen.
-
Josef Lang – k.k. Scharfrichter

Josef Lang war berühmt. Oder berüchtigt. Oder beides. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts war der Beruf des Henkers noch Projektionsfläche für Aberglauben. Lang erhielt Post. Viel Post, wie er berichtete. Von Frauen und Männern, Bauern und Adligen, Wahnsinnigen und Frommen. Sie wollten ein Stück vom Strick, einen Segen, einen Fluch, ein „Zauperwort“ das den Geist des toten Kindes vertreibt oder einen Tropfen Urin für die Schläfen und manchmal einen Besuch. Die Damen der Gesellschaft sollen ihn umschwärmt haben. Einmal habe ihn eine junge Dame gebeten, eine Strangulation zu demonstrieren. An ihr.
-
Johannes Bückler – der „Schinderhannes“

„Bewohner der lachenden Ufer des Rheins, ich bin beauftragt, Euch an den Wohltaten der Gesetze teilnehmen zu lassen, nach welchen die Franzosen regiert werden“, verkündete der zur Verwaltung der von den französischen Truppen im sog. Ersten Koalitionskrieg eroberten Gebiete eingesetzte Regierungskommissar François Joseph Rudler im Dezember 1797 den frischgebackenen französischen Staatsbürgern. Im Frühsommer 1802 war Johannes Bückler überhaupt nicht nach republikanischen Wohltaten zumute. Er war seit dem 31. Mai im deutschen Frankfurt am Main inhaftiert und ahnte, dass ihm bei einer Auslieferung an die französischen Behörden das Fallbeil drohen würde.